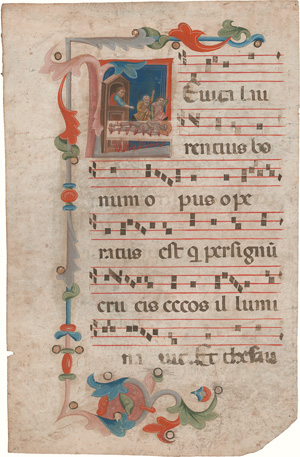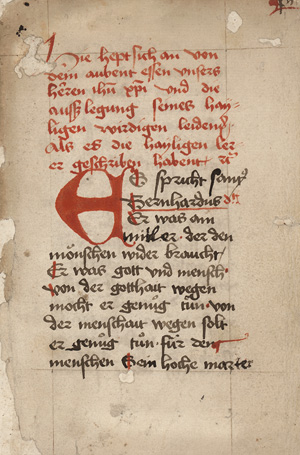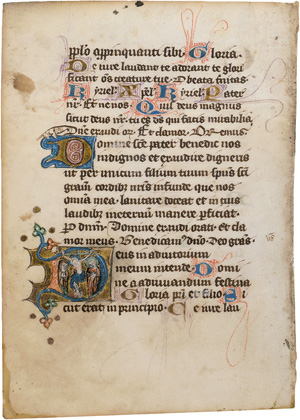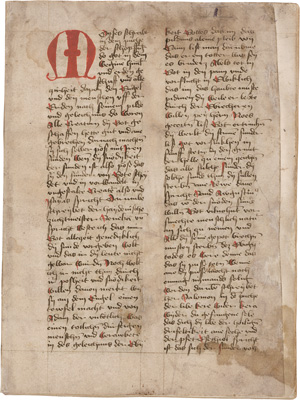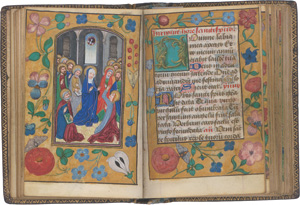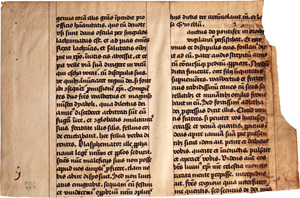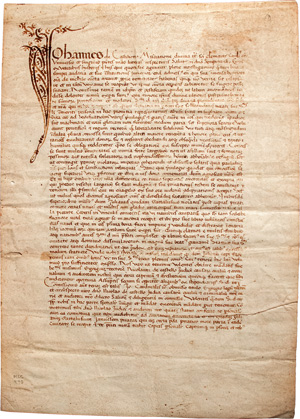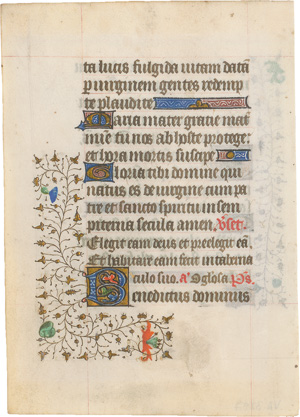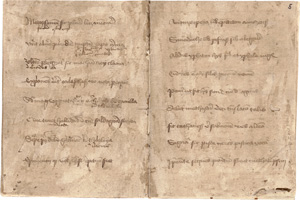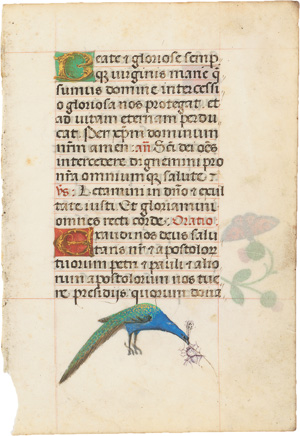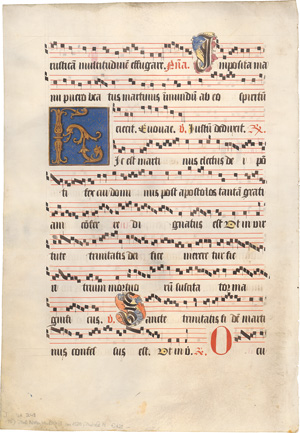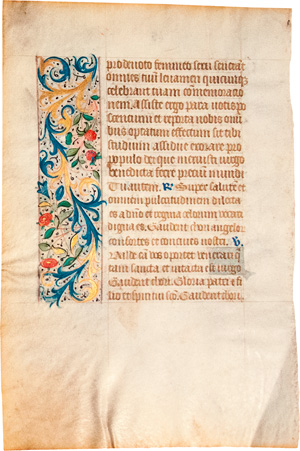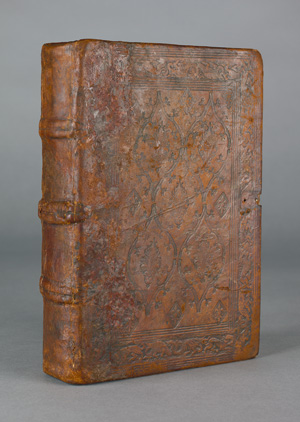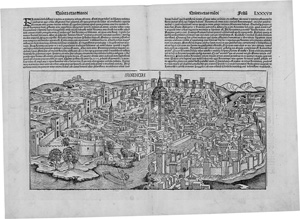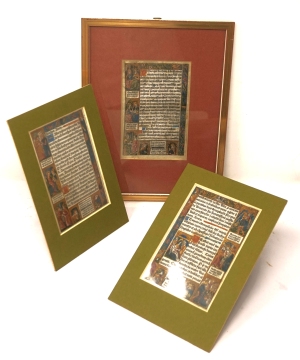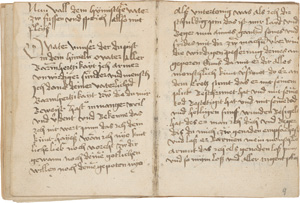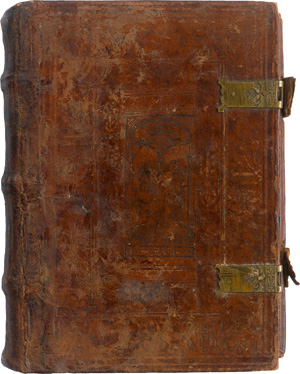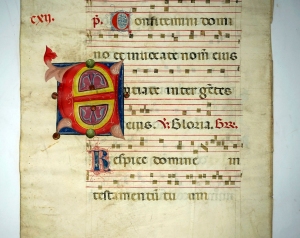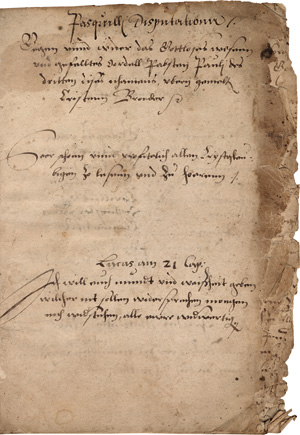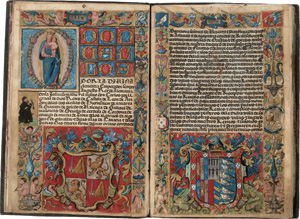[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.
* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.
Galerie Bassenge
Erdener Str. 5A
14193 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,
Freitag, 10–16 Uhr
Telefon: +49 30 8938029-0
Fax: +49 30 8918025
E-Mail: info (at) bassenge.com
Impressum
Datenschutzerklärung
© 2024 Galerie Gerda Bassenge
Galerie Bassenge
Erdener Str. 5A
14193 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,
Freitag, 10–16 Uhr
Telefon: +49 30 8938029-0
Fax: +49 30 8918025
E-Mail: info (at) bassenge.com
Impressum
Datenschutzerklärung
© 2022 Galerie Gerda Bassenge